




Beitrag 13
Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung
Beitrag 13
Die auf dieser Seite über die Links von Ihnen aufgerufenen Webseiten benutzen Sie eigenverantwortlich
und auf eigenes Risiko! Beachten Sie auch den im Impressum erklärten Haftungsausschluss!
|
Auf hoher See und vor Gericht an Land
befindet man sich in Gottes Hand!
(Norddeutsche Spruchweisheit)
da mihi facta, dabo tibi ius
"Gib mir die Tatsachen, ich werde Dir das (daraus folgende) Recht geben!"
 Rechtsanwalt Friedrich Ramm
Rechtsanwalt Friedrich Ramm
Prozessrecht: Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung
1. Allgemeines
In der Beweiswürdigung bildet sich das Gericht die Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer (behaupteten) Tatsache. Hierbei hat es unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine Tatsache bewiesen oder nicht bewiesen ist. Nur soweit gesetzliche Vermutungen und Beweisregeln in der zu entscheidenden Angelegenheit eingreifen, ist das Gericht daran gebunden.
Soweit dies nicht der Fall ist, kann das Gericht
* eine bestrittene Tatsache auch ohne Beweisaufnahme für wahr halten,
* einer unbeeideten Zeugenaussage mehr als einer beeideten Aussage glauben,
* einem Zeugen überhaupt nicht und statt dessen einer Prozesspartei glauben.
Für die Überzeugung des Gerichts genügt ein so hoher Grad an Wahrscheinlichkeit, dass vernünftige Zweifel schweigen.
2. Beweislast
2.1. Einzelheiten
Ist das Gericht weder von der Wahrheit noch von der Unwahrheit einer Tatsache überzeugt, so kommt es, soweit der Verhandlungsgrundsatz 1) gilt (dies ist überwiegend im Zivilprozess der Fall), auf die Beweislast an. Beweislast bedeutet, dass grundsätzlich jede Prozesspartei für die Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsnormen Beweis erbringen muß.
Es muss also zum Beispiel derjenige, der einen Anspruch geltend macht,
die Tatsachen, welche den Anspruch begründen, vortragen und im Falle des Bestreitens durch die Gegenseite unter Beweis stellen.
Der von der beweisbelasteten Partei geführte Beweis kann durch Gegenbeweis der anderen Seite erschüttert werden.
Grundsätzlich gilt:
Bewiesen werden muss nicht,
* was von der Gegenseite anerkannt wurde bzw. nicht bestritten wird,
* was offenkundig (gerichtsbekannt) ist,
* was gesetzlich vermutet wird (gesetzliche Vermutung),
* was ohne weiteres unterstellt werden kann,
* was als sogenanntes gleichwertiges, also der anderen Prozeßpartei günstiges,
Vorbringen des Prozessgegners zu werten ist.
Steht nach der vom Gericht getroffenen Beweiswürdigung nicht fest, ob die behauptete Tatsache wahr oder unwahr ist [non liquet 2)], wird zuungunsten dessen entschieden, der die Beweislast trägt (sogenannte
non-liquet-Entscheidung).
Im Strafprozess, in dem nicht der Verhandlungsgrundsatz, sondern der Amtsermittlungsgrundsatz 3) gilt, muss das Gericht, wenn es weder von der Wahrheit noch von der Unwahrheit einer Tatsache überzeugt ist, sich zugunsten des Angeklagten entscheiden. Es gilt dann nämlich der Grundsatz "in dubio pro reo" (im Zweifel für den Angeklagten).
Zum Grundsatz "in dubio ro reo" hier klicken!
 Online-Beratung Online-Beratung 
* Erstberatung * Zweitberatung * Projektberatung
Rechtsanwaltsbüro Friedrich Ramm
- Regionale und bundesweite Tätigkeit -
* Vertragsrecht * Arbeitsrecht * Gewerberecht *
* Handwerksrecht * Handelsrecht * Unternehmensrecht *
* Verkehrsrecht * Schadensersatzrecht * Versicherungsrecht *
* Reiserecht * Sportrecht (Fußball- u. Radsport, Sportstudio) *
* Immissionsschutzrecht (insbesondere das Thema "Lärm") *
* Tierrecht * Mietrecht * Wohnungseigentumsrecht *
* Strafverteidigung * Bußgeldsachen-Verteidigung *
|
2.2. Umkehr der Beweislast
Die Beweislast kann durch gesetzliche Vorschriften oder durch sogenanntes Richterrecht 4) umgekehrt sein (Umkehrung der Beweislast).
Nun könnte ein Schlaukopf darauf kommen, die Beweislast in einem Vertragsverhältnis durch eine entsprechende Klausel zu seinen Gunsten umzukehren. Jedoch wäre eine solche vertragliche Bestimmung gemäß § 309 Satz 1 Nr. 12 Buchstabe a BGB unwirksam, wenn der Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteiles ändert, insbesondere indem er diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders selber liegen.
Auch eine Beweislastumkehr dahingehend, dass der Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen sich von dem anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen läßt, ist gemäß § 309 Satz 1 Nr. 12 Buchstabe b BGB unwirksam, es sei denn, dass es sich um ein Empfangsbekenntnis handelt, welches gesondert unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.
3. Beweismittel
Sofern und soweit gesetzliche Beweisregeln bestehen, darf der Beweis im Zivilprozess nur durch bestimmte Beweismittel wie
* richterlicher Augenschein (§ § 371 ff. Zivilprozeßordnung - ZPO -),
* Zeugen (§ § 373 ff. ZPO),
* Sachverständige (§ § 402 ff. ZPO),
* Urkunden (§ § 415 ff. ZPO),
* Parteivernehmung (§ § 445 ff. ZPO)
geführt werden ( § 286 Abs. 1 ZPO). Insoweit ist die freie Beweiswürdigung des Gerichts eingeschränkt.
Merkhilfe für die gesetzlichen Beweismittel ( SAPUZ)
S = Sachverständiger
A = Augenschein
P = Parteivernehmung
U = Urkunde(nbeweis)
Z = Zeuge(nbeweis)
4. Schriftliche Beweiswürdigung
Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei ( freie Beweiswürdigung,
§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO). In dem Urteil sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind (Abs. 2). Die Beweiswürdigung ist also in die Entscheidungsgründe des Urteils aufzunehmen, und zwar in der Weise, dass sie nachvollziehbar ist.
Hierdurch wird das Recht der Prozessparteien gewährleistet, zu erfahren, weshalb das Gericht einen bestimmten Sachverhalt als erwiesen ansieht oder nicht. Außerdem wird das Gericht dazu angehalten, eine präzise Eigenkontrolle seiner Überzeugungsbildung durchzuführen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann einen Fehler macht.
Aus all dem ergibt sich, dass nur das (schriftlich) Begründbare, und zwar dasjenige, was einem Dritten nachvollziehbar darstellbar ist, festgestellter Sachverhalt und damit legale Entscheidungsgrundlage sein darf.
_____
1) Verhandlungsgrundsatz bedeutet, dass (im Zivilprozess) die Prozessparteien bestimmen, welche Tatsachen sie dem Gericht im Rechtsstreit zur Entscheidung unterbreiten und welche Tatsachen beweisbedürftig sind. Das Gericht darf also die Beweise nicht selbst beschaffen, sondern verwertet grundsätzlich nur das, was ihm die Prozessparteien vortragen. Allerdings gilt der Verhandlungsgrundsatz im Zivilprozess nicht durchgängig. So gilt er zum Beispiel in Kindschaftssachen (§ § 640 ff. ZPO) nicht.
2) "es ist nicht klar".
3) Das Gegenteil des Verhandlungsgrundsatzes ist der Untersuchungsgrundsatz (auch als Amtsermittlungsgrundsatz bezeichnet). Dort, wo der Untersuchungsgrundsatz gilt, hat das Gericht die für die
Entscheidung des Rechtsstreits erheblichen Tatsachen von Amts wegen zu ermitteln, in den Prozess einzuführen und ihre Wahrheit festzustellen.
4) Richterrecht ist Recht, welches von den Gerichtsbarkeiten, also der Judikative, selbst geschaffen wird. Es entsteht in Ausfüllung von Gesetzeslücken oder in solchen Fällen, in denen die Anwendung des (Zivil-)Gesetzes zu unbilligen Ergebnissen führen würde. Richterrecht ist nicht
einheitlich auf Grund der Unabhängigkeit des einzelnen Richters, welcher
nur dem Gesetz und seinem Gewissen verantwortlich ist. So darf er Fehler in vorgefundenen Entscheidungen höherer Gerichte nicht übernehmen sondern hat, soweit es sein höchstpersönliches Gesetzes- und Rechtsverständnis gebietet, auch von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowie von Entscheidungen sonstiger ihm übergeordneter Gerichte abzuweichen.
Erstberatung * Zweitberatung * Projektberatung
Kosten der Online-Beratung (6 Berechnungsbeispiele): Hier klicken!
|
|
RECHTSANWALTSBÜRO FRIEDRICH RAMM
|
|
|
|
|
|
Situationen, in denen sofort anwaltliche
Hilfe in Anspruch genommen werden sollte:
Hier klicken!
|
|
Standortadresse und Besprechungstermine
RECHTSANWALTSBÜRO FRIEDRICH RAMM:
Hier klicken!
|
|
Was kann Rechtsanwalt Friedrich Ramm
für Sie im Einzelnen tun (Arbeitsbereiche):
Hier klicken!
|
|
Für Berufskollegen und Berufskolleginnen
Übernahme von Terminsvertretungen
Hier klicken!
|
|
Rechtsgebiete und spezielle Arbeitsfelder,
in denen der Rechtsanwalt für Sie
tätig sein kann: Hier klicken!
|
|
Bei welchen Gerichten kann der
Rechtsanwalt für Sie auftreten?
Hier klicken!
|
|
Wenn Sie die Möglichkeit der Erstberatung
wahrnehmen wollen: Hier klicken!
|
|
|
Das Rechtsanwaltsbüro Friedrich Ramm ist
sowohl regional als auch bundesweit tätig!
Es ist somit egal, ob Sie auf einem Dorf, in einer Kleinstadt
oder einer Großstadt Ihr Zuhause oder Ihre Arbeit haben oder
dort einer unternehmerischen Tätigkeit nachgehen.
|
 Online-Beratung Online-Beratung 
* Erstberatung * Zweitberatung * Projektberatung
Rechtsanwaltsbüro Friedrich Ramm
- Regionale und bundesweite Tätigkeit -
* Vertragsrecht * Arbeitsrecht * Gewerberecht *
* Handwerksrecht * Handelsrecht * Unternehmensrecht *
* Verkehrsrecht * Schadensersatzrecht * Versicherungsrecht *
* Reiserecht * Sportrecht (Fußball- u. Radsport, Sportstudio) *
* Immissionsschutzrecht (insbesondere das Thema "Lärm") *
* Tierrecht * Mietrecht * Wohnungseigentumsrecht *
* Strafverteidigung * Bußgeldsachen-Verteidigung *
|
Zeithonorar
(gestaffelt nach Gegenstandswert)
Vergütungsliste A
für die Erstberatung
Hier klicken!
|
Zeithonorar
(gestaffelt nach Gegenstandswert)
Vergütungsliste B
für Beratung und Vertretung
sowie sonstige auftragsbezogene
Tätigkeit des Rechtsanwalts
Hier klicken!
|
|
|
|
|
Nottelefon: (0152) 58 44 77 39 (für Gespräche außerhalb der üblichen Geschäftszeiten)
|
|
Informationen zu den Rechts- und Tätigkeitsgebieten sind über die grünen Buttons anklickbar!
|





* Rechtsberatung * Rechtsanwalt * Rechtsdurchsetzung *
* Online-Beratung * Beratung per E-Mail oder Telefon * Beratung hier im Büro oder vor Ort *
|
Besprechungstermine nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: Montag bis Freitag 8.30 - 17.00 Uhr
Besprechungen sind auch abends und am Wochenende möglich
(speziell für Berufstätige und Geschäftsleute).
|
 Anfahrts/Wegbeschreibung
Anfahrts/Wegbeschreibung

Kanzleistandort: 26789 Leer * Schwarzer Weg 5
Fon (0491) 7 11 22 * Mobil (0152) 58 44 77 39
E-Mail: rab-friedrich-ramm@online.de
Ostfriesland - Niedersachsen - Deutschland
- Regionale und bundesweite Tätigkeit -
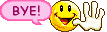
* Online-Beratung * Beratung per E-Mail oder Telefon * Beratung hier im Büro oder vor Ort *
* Rechtsberatung * Rechtsanwalt * Rechtsdurchsetzung *

Tags:
Amtsgericht Leer, Anscheinsbeweis, Anwalt, Augenschein, Augenscheinsbeweis, Augenscheinseinnahme.
Beweis, Beweisantritt, Beweisbeschluss, beweisen, Beweisführer, Beweisführung, Beweislast, Beweislastumkehr, Beweisnot, Beweiswürdigung.
darlegen.
Ermittler, Ermittlung, Ermittlungsgrundsatz.
Grundsatz der freien Beweiswürdigung.
Landgericht Aurich.
Oberlandesgericht Oldenburg.
Partei, Parteivernehmung, prima facie Beweis (Beweis des ersten Anscheins), Prozesspartei.
Rechtsanwalt - Leer.
Sachverständiger, Sachverständigenbeweis, SAPUZ (Merkhilfe für die Beweismittel Sachverständiger, Augenschein, Partei, Urkunde, Zeuge).
Urkunde, Urkundenbeweis.
Verhandlung, Verhandlungsgrundsatz (zum Beispiel die Mündlichkeit).
Zeuge, Zeugenbeweis, Zeugengeld, Zeugenvernehmung.
|
Freie Beweiswürdigung Grundsatz (Bearbeitungsstand des Beitrags 13: 05/2024) Grundsatz Freie Beweiswürdigung
* * *
Ende der Beitrag-13-Seite der Homepage des RECHTSANWALTSBÜROS FRIEDRICH RAMM
* * *
|
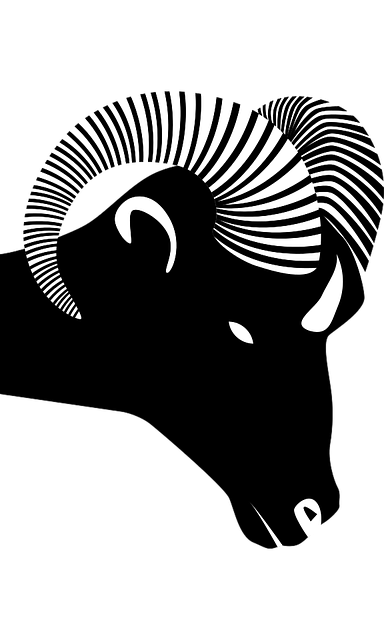


 Rechtsanwalt Friedrich Ramm
Rechtsanwalt Friedrich Ramm